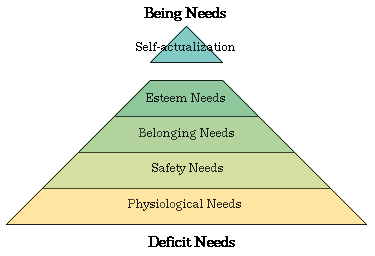Gesellschaft
Politik
Angriff auf die Menschenwürde
Verbale Ausritte heimischer Spitzenpolitiker und ihre Wirkung auf die Bevölkerung: Psychotherapeutin Rotraud A. Perner im SN-Interview mit Elisabeth Horvath.

Rotraud A. Perner
in: Salzburger Nachrichten, 30. 7. 2001
Wie bezeichnen Sie als Psychotherapeutin den Sprachstil führender Politiker in Österreich?
Stil ist da schon ein Hilfswort, es ist ein Unstil, es ist nicht einmal Kabarettstil, es ist einfach ordinär. Ohne jemanden beleidigen zu wollen, es ist proletenhaft. Es ist ein eindeutiges Einschüchterungsverhalten. Wenn man den typischen Proletenstil in der Sprache analysiert, dann hat das überhaupt nichts mit der Herkunft zu tun, es ist eine bewusste Verweigerung eines respektvollen Umgangs, um andere zu schockieren. Ich sehe darin eine Entwicklung, die mit Haider begonnen hat. Haider als Hobbykabarettist. Es geht nur mehr um mediengerechte Formulierungen, um eben damit in die Medien zu kommen.
Jetzt formulieren sogar schon ÖVP-Spitzenleute "der siebente Zwerg von links".
Ja, schade und gerade von Andreas Khol! Einem Hochschulprofessor, der schon von der Spröde seiner Sprache her zu wenig Charme besitzt, um sich so etwas erlauben zu können.
Neben diese Proletensprache, wie Sie sagen . . .
. . . tritt zur Einschüchterung des Gegners die Verhetzung des Publikums.
Meinen Sie damit die öffentlichen Schauprozesse gegen Sallmutter, Sundt, die AUA-Vorstände?
Nein, das meine ich nicht. Mit Verhetzung meine ich, Menschen die Menschenwürde zu nehmen, indem man sie zu Untermenschen und damit zum Freiwild macht.
Rotraud A. Perner, Jahrgang 1944, Rechtswissenschafterin, Psychotherapeutin und Psychoanalytikerin, gründete 1984 das Institut für Projektberatung, Personal Training und Supervision (IPPS). Perner lehrt als einzige Hochschulprofessorin in Österreich Gewaltprävention an der Universität Wien.
Die "roten Gfrießer"?
Zum Beispiel. Das war bei Politikern früher nicht üblich. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, als ich Politikerin war, hat es diese Töne zwar auch gegeben - aber von der "Basis".
Hat diese Verrohung in der politischen Sprache einen Einfluss auf die Bevölkerung?
Ja, es hat einen Einfluss. Man darf nicht vergessen, Politiker sind eine Art Elternersatzfigur . . .
. . . die Vorbildwirkung haben?
Es hat mich immer gestört, wenn Kasperltheater gespielt wird, wenn die politische Diskussion von der sachlichen Ebene in eine emotionale abgleitet. Wehrt sich jemand, heißt es, das war ja nur Spaß. Doch gerade in der Politik muss alles ernst gemeint sein. Da geht es um Vertragstreue, um Diplomatie. Politik heißt, Interessenskonflikte in einer Weise zu lösen, dass nicht ein wesentlicher Teil der Bürgerschaft vernichtet wird.
Denken Sie dabei nicht auch an
die Mitläufer in Mobbingfällen?
Wie wirkt das also in die Gesellschaft hinein? Es läuft folgendes Muster: Wir neigen dazu, uns mit dem Aggressor zu identifizieren. Wenn es Polarisierung gibt, stehen auf der einen Seite die Mächtigen, auf der anderen jene, die Macht nicht haben, die die Mächtigen als Schutz brauchen, als Interpreten. Wenn nun die Mächtigen Machtmissbrauch treiben, schlagen sich die Ohnmächtigen auf die Seite der Mächtigen, um nicht Adressaten dieser Gewalt zu sein: Identifikation, um auf der "sicheren" Seite - das ist die der Gewalttäter - zu sein. Widerstand zu leisten ist vielen zu anstrengend. Gerade das aber ist in der Demokratie wichtig. Die Menschen gieren
nach den "fünf
Minuten Berühmtheit"Führt dieser Prozess letztlich zur Verrohung einer Gesellschaft? Natürlich, das wissen wir aus der Gewaltforschung. Aus einer Studie über Männer, die als Kinder sexuell misshandelt wurden, geht hervor: Wenn sie sagen, es war furchtbar, sie haben gelitten, sie hatten Angst, diese Männer tun dasselbe nicht wieder. Jene Männer aber, die sagen, es war nicht so arg, die tun genau dasselbe an ihren eigenen Kindern. In der Psychoanalyse nennen wir das den Wiederholungszwang. Und jetzt kommt noch die Aufmerksamkeit durch die Medien dazu. Die Menschen gieren nach den "fünf Minuten Berühmtheit". Somit wird jener Sprachstil übernommen, der sie in die Medien bringt. Wie dies jetzt auch ÖVP-Funktionäre tun. Das ist das klassische NLP-Spiel: Man weiß, dass die FPÖ einen zeitlichen Vorsprung hat, weil sie mit dieser Schulung schon früher begonnen hat. NLP als Technik heißt, ich verwende eine Sprache, die im Denken der anderen Person geistige Bilder hervorrufen muss. Beispiel "Treffsicherheit", da hat man eine Schießscheibe vor Augen. Beim "7. Zwerg" ist klar, dass ich jemanden sehr klein mache. Und bei den "roten Gfrießern" weiß ich nicht, wer gemeint ist. Sind es die Journalisten, die Politiker?
Jedenfalls Sozialdemokraten.
Mit solchen Formulierungen kann man Menschen in ihrem Immunsystem schädigen. Dieser Schlag ins Selbstwertgefühl des anderen löst aus, dass diese Person entweder hochaggressiv zurückschlägt oder sie muss sich so zurückhalten, dass sie höchstwahrscheinlich erkrankt. Das ist eine Vernichtungsstrategie. Zurückgehaltene Aggression wirkt psychosomatisch oder macht depressiv. Menschen als nicht gleichwertig zu definieren, zielt darauf ab, diese wegzubekommen, da sie sich ja nicht mehr trauen, Paroli zu bieten.
Auch dies erinnert erschreckend an die 30er und 40er Jahre.
Heute läuft das mittelbar über die Medien.
Damit diese Feindbildpolitik bei den Wahlen Erfolge erzielt.
Das funktioniert allerdings nicht unbedingt. Das haben die letzten Wahlen ja schon gezeigt. Wenn die Strategie ist, Feindbilder aufzubauen, einzuschüchtern, damit kein Widerstand entsteht - merken das die Leute. So blöd sind sie nicht. Das zeigen die Wahlergebnisse.
Sie meinen in Wien die Absolute für die SPÖ?
Nicht nur - die Wahlen in der Steiermark und im Burgenland zeigten dasselbe. Manche sagen ja auch, hätte Haider nicht in den Wiener Wahlkampf eingegriffen, hätte Partik-Pablé viel besser gepunktet.
Aus dem könnte man allerdings folgern, dass die Gesellschaft eher in Abwehrstellung geht. Sie sehen also nicht die Gefahr der Verrohung?
Die Gefahr ist dann da, wenn die Medien unkritisch transportieren. Derzeit wird Kritik immer mittransportiert und damit erreicht man zumindest Personen, die die Medien konsumieren.

Jede Perspektive ermöglichen
und fördern
macht das Leben bunter
und interessanter