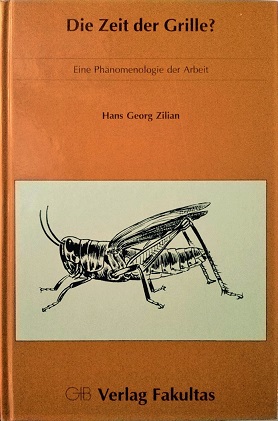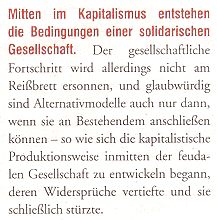|
||||
|
Das Wesen und der Ursprung der Direkten Demokratie
in der Schweiz besteht darin, dass sich freie und gleiche Bürger
zusammenschliessen, um anstehende Aufgaben zum Nutzen aller in
gemeinsamer Verantwortung zu regeln. Dazu dienten und dienen
Kooperativen, Genossenschaften, Vereine, Aktiengesellschaften
mit einer Aktie pro Person und sehr beschränktem Recht auf
Verkauf sowie ähnliche Vereinigungen, durch die die bestmöglichen
Massnahmen für das Wohl der Mitglieder gemeinsam getroffen
werden und dabei dem Allgemeinwohl dienen. Text entnommen aus: Kooperationfähigkeit der Bürger als Grundlage der Direkten Demokratie, Verein für Direkte Demokratie und Selbstversorgung, 27. Juli 2009 |
|
||||
|
Lebendige Zivilgesellschaft in Selbstorganisation Eine Sammlung von Gedanken zum Thema |
|||||
 |
|||||
|
Wer LEBEN hat, hält sich an seine Pflicht, wer kein LEBEN hat, hält sich an sein Recht. [Lao Tse, Tao Te King, Kap. 79] |
Netzwerke kleiner überschaubarer Gruppen, die sich aufeinander "einschwingen", sind dissipative Strukturen; sie sind das Organisationsmodell der Zukunft. Die Menschen in den Gruppen sind Resonanzkörper; sie schwingen - wie Stimmgabeln - wenn sie in ihrer Frequenz angesprochen werden. Wolfgang Berger, Business Reframing, |
||||
|
Fair ist ein Wettbewerb dann, wenn die Grundlage dabei Vielfalt ist, die in Wechselwirkungen lebt. Unter Beachtung des Prinzips der Effizienz/Effektivität innerhalb sowie der Nicht-Eindringtiefe über Grenzen hinaus führt dies zu allseitig vorteilhafter Evolution im Sinne (+/+): Jeder Beteiligte hat seinen Vorteil. Die Ko-Prosperität geht in Richtung „fairer Wettbewerb"! Ein „Wettbewerb fair" motiviert doch jeden kreativen Menschen, etwas besser machen zu wollen! Das in der Natur auch zu findende eingriffstiefe Verhalten des Räuber-Beute-Verhaltens hat mit Wettbewerb freilich nichts mehr zu tun und sollte vom Menschen aus Einsicht in das Ganze Kraft seines Geistes unterlassen werden. Anton Moser, |
||||
|
Die Ausweitung des informellen Sektors ist auch deshalb eng begrenzt, da die zentralisierte ökonomische und politische Macht im formellen Sektor gestützt wird durch starre und hierarchisch strukturierte Bürokratien. Er ist somit kaum "von außen" zu begrenzen, sondern vor allem durch Entflechtung und einen Herrschaftsabbau "von innen". Rolf Cantzen, Weniger Staat - Mehr Gesellschaft, Grafenau: Trotzdem-Verlag, 3. Aufl., Juli 1997, S 131 |
Unser Engagement
für nachhaltige Entwicklung Das Gesamtziel der neuen EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung besteht darin, Maßnahmen zu ermitteln und auszugestalten, die die EU in die Lage versetzen, eine kontinuierliche Verbesserung der Lebensqualität sowohl der heutigen als auch künftiger Generationen zu erreichen, indem nachhaltige Gemeinschaften geschaffen werden, die in der Lage sind, die Ressourcen effizient zu bewirtschaften und zu nutzen und das ökologische und soziale Innovationspotenzial der Wirtschaft zu erschließen, wodurch Wohlstand, Umweltschutz und sozialer Zusammenhalt gewährleistet werden. vgl. auch "Erklärung Lebensraum Land", entstanden am 10. und 11. November 2006 im Bildungshaus St. Magdalena in Linz im Rahmen einer Open Space-Veranstaltung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Österreich und dem Ökosozialen Forum - einer von vielen Versuchen, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und damit naturnahere und sozialere Lebensweisen zu fördern. |
||||
|
STANDARD: Wenn Sie an die Weltwirtschaft denken, sehen
Sie dann ein großes Schachbrett oder viele kleinere nebeneinander,
auf denen gleichzeitig gespielt wird? Aus dem Interview von Günther Strobl [DER STANDARD] mit dem amtierenden Schachweltmeister und studierten Betriebswirt Viswanathan Anand, nachzulesen in: Der Standard, 14. Mai 2009, S 24 |
|||||
|
|
 |
||||
|
- Ökologisches Bewusstsein - Kooperation - Wirtschaftsunternehmen - Gemeinwesenorientierung |
|
||||
| > beispielgebende Werbeaktion von www.blackaustria.at | |||||
|
|
Alternativen zur ökonomischen Globalisierung, John Cavanagh (Vorsitzender des VerfasserInnen-Komitees), Frühjahr 2002, S 6 |
||||
|
|
|||||
|
|||||
|
Im Übrigen gilt das nebenstehend Geschriebene auch für sogenannte "ethische" Veranlagungen z. B. hinsichtlich best-in-class-Einkaufsstrategien als gewissensberuhigende (Verkaufs-)Argumentationshilfe für die Beteiligungen an klimaschädlichen Ölgesellschaften, Autokonzernen etc. und insbesondere auch dort, wo sich die Realwirtschaft verschleiert hinter dem Beteiligungs-/Zahlenvorhang verbirgt: Versicherungsunternehmen, Banken, Consultingunternehmen etc; Unternehmen, die nicht ausdrücklich (gemeint ist damit nicht das CSR-Mäntelchen als grüner Umhang) einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zuzuordnen sind. |
höhere Erträge erfordern höheres Risiko. |
||||
|
Heinz-Otto Peitgen, in: Technology Review, Juni 2006, S 50 |
|||||
|
Die wahrhafte Rationalität besteht vielmehr darin, die Arbeit in eine "persönliche Tätigkeit" umzuwandeln, aber auf höherem Niveau: Die "freiwillige Vereinigung" der Individuen wird an Stelle der kapitalistischen Arbeitsteilung "freiwillige Zusammenarbeit" setzen und den gesellschaftlichen Produktionsprozeß der Kontrolle der assoziierten Produzenten unterwerfen. André Gorz, Kritik der ökonomischen Vernunft, Berlin: Rotbuch Verlag, 3. Aufl., 1990, S 46 Mutiert der "antiquierte" Mensch in einer "Null-Fehler-Kultur" selbst zum größten anzunehmenden Unfall und Risikofaktor? aus dem Klappentext zu Manfred Ostens Buch: Die Kunst, Fehler zu machen, Suhrkamp Verlag Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder die Erde wird privatisiert, oder wir bauen auf und mit ihr eine neue gemeinsame Welt, unsere 'Gemeinheit', eine Art globale Allmende! Claudia v. Werlhof, Rede zu GATS mit bitterem Nachsatz, Linz, 4. 6. 2004 |
Der Titel „Wir Helden“ eines Presse-Artikels von Franz Schandl weist uns den Weg, denn eine lebendige Zivilgesellschaft ist sich selbst Held! Sie ist sich ihrer eigenen Energie als Gestaltungskraft bewusst und handelt auch entsprechend [vgl. Sozialcharta, Peter Sloterdijk: "Gottes Eifer", ...]. Wie mehr Solidarität unter Produzierenden und Nachfragenden [z. B. von sozialen Leistungen] über das Korrektiv herkömmlicher politischer Verantwortung hinaus aussehen kann zeigt dieser Auszug aus den Lizenzvereinbarungen zu SpyBot - Search & Destroy 1.4: |
||||
|
I. Freeware I.a. Widmung I.b. Binäres I.c. Folgerung |
|||||
|
in: Wu und Hu schlagen Ben, WOZ, 24. 1. 2008 |
|
||||
|
Eine Gesellschaft ohne sensible Berater kommt irgendwann in Schwierigkeiten, denn ihr fehlt das nötige Korrektiv, gegen den Kult des Stärkeren und die Jagd nach kurzfristigen Erfolgen. |
Dr. Marianne Skarics, Sensibel kompetent - zart besaitet und erfolgreich im Beruf, Wien: Festland-Verlag, S 33 |
||||
Die Kämpfe, die es auszufechten gilt, müssen daher global geführt werden. Bürgerliche Schizophrenie ist mehr als eine Krankheit infantilisierter Marktgesellschaften. Sie ist ein Leiden des globalen Marktes. Eine Therapie, die das Leiden nur innerhalb der Grenzen von Nationalstaaten angeht, wird nicht ausreichen. Entweder muß die Demokratie globalisiert werden, oder die Globalisierung muß demokratisiert werden. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. |
|||||
|
|
|||||
|
|
|
||||
 |
Wie lautet die
Alternative zur
Elias Canetti über den Machthaber:
aus: Masse und Macht, Frankfurt am Main: Fischer, Juni 1991, S 326 |
||||
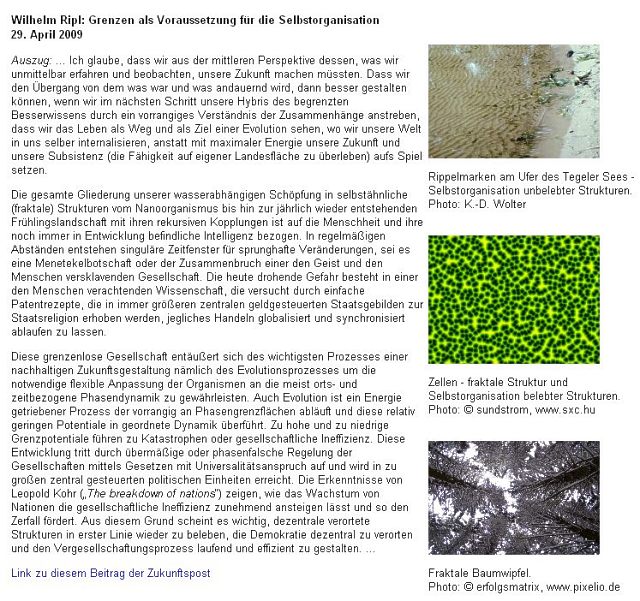 Auszug aus dem Weblog "Zukunftspost", 15. 3. 2010, 19:57 h - Linkadresse zum Beitrag |
|||||